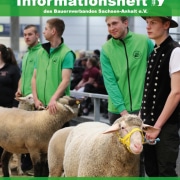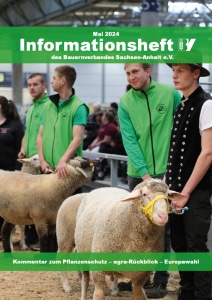Pressemitteilung zum Vorernte-Gespräch 2024
Vorernte-Gespräch 2024
Landwirte, Landhandel und Vertreter des MWL haben sich anlässlich der anstehenden Ernte ausgetauscht. Viele Bestände machen einen guten Eindruck, entscheidend werden die Qualitäten und die Marktentwicklung sein. Eine erste Ernteprognose wird in der letzten Juni-Woche erfolgen.
Nach aktuellem Stand sind die Kulturen weitestgehend gut entwickelt. Im Frühjahr haben vernässte Flächen in einigen Regionen dazu geführt, dass die Feldarbeiten nicht termingerecht durchgeführt werden konnten. Die Niederschlagsverteilung in Sachsen-Anhalt stellte sich seit dem Vegetationsbeginn sehr unterschiedlich dar. Die Meinungen der Praktiker reichen von viel zu trocken bis viel zu nass und zu kühl. Nach aktuellem Stand geht der Bauernverband Sachsen-Anhalt davon aus, dass die Getreideernte in diesem Jahr sehr zeitig beginnen wird.
Wie immer wird die Ernte eine enorme Logistik-Leistung. Mit Beginn der Gersten-Ernte im späten Juni bis in den Winter, wenn die Zuckerrüben-Kampagne läuft, müssen Landwirte, Anbauverbände, Dienstleister, Handel und Verarbeiter gemeinsam für reibungslose Abläufe sorgen. Das Vorernte-Gespräch des Bauernverbandes dient auch dazu, sich über Erfahrungen der letzten Saison und mögliche Stolpersteine auszutauschen. Staatssekretär Gert Zender warb dafür, bei Unklarheiten direkt auf das Ministerium zuzukommen, um Lösungen zu finden.
Weitere Themen, die von den Fachleuten diskutiert worden sind, waren die Kostenentwicklung und die Zukunft von Sonderkulturen in Deutschland. Die Kosten sind für Landwirte wie auch den Landhandel in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Insbesondere 2023 konnten die hohen Ausgaben bei Betriebsmitteln durch gute Erzeugerpreise ausgeglichen werden. Ob diese Rechnung 2024 nochmals gelingen kann, ist fraglich. Dafür werden auch die Ernten in anderen Teilen der Welt entscheidend sein, etwa der Schwarzmeerregion. Zentral für die Preisentwicklung sind Angebot und Nachfrage auf dem Weltmarkt.
Auch der Anbau von Sonderkulturen, wie etwa Gemüse und Gewürzpflanzen, steht unter Kostendruck, maßgeblich durch Energie- und Lohnkosten, die in anderen EU-Ländern deutlich niedriger sind. Der Rückgang von Sonderkulturen liegt aber mehr noch daran, dass die Handlungsmöglichkeiten gegen Pilze und Schädlinge immer weiter beschnitten werden. Bei Sonderkulturen müssen Betriebe meist mit mehreren tausend Euro pro Hektar in Vorleistung gehen, in der Hoffnung auf eine gute Ernte. Wenn keine Pflanzenschutzmittel zum Schutz dieser Pflanzen zur Verfügung stehen, gehen immer weniger Betriebe dieses Risiko ein.
Zum traditionellen Gespräch vor der Ernte, das am 19. Juni im Haus der Landwirtschaft in Magdeburg stattfand, hat der Bauernverband Sachsen-Anhalt e.V. eingeladen, vertreten durch Bauernpräsident Olaf Feuerborn sowie mehrere Vorsitzende von Fachausschüssen. Erstmals hat Staatssekretär Gert Zender aus dem Landwirtschaftsministerium teilgenommen, vom Agrarhandel waren sechs Unternehmen vertreten. Die Zuckerrübenanbauverbände Magdeburg und Könnern nahmen teil, um einen Überblick zu den Beständen zu geben, die in diesem Jahr teils erst im Mai ausgesät werden konnten.
Information für Journalistinnen und Journalisten
Wenn Sie Interview- sowie Drehpartner zur Ernte 2024 suchen, stellen wir gerne einen Kontakt zu einer regionalen Landwirtin / einem regionalen Landwirt für Sie her. Wenden Sie sich dafür bitte an presse@bauernverband-st.de