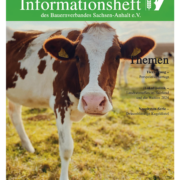Kommentar der Verbandsspitze im Informationsheft 08/2023
Werte Mitglieder, liebe Bäuerinnen und Bauern,
seit dem Deutschen Bauerntag in Münster ist bereits einige Zeit vergangen. Zurückblickend kann gesagt werden, dass die Veranstaltung erfolgreich war. Der Austausch zwischen den Akteuren der Landwirtschaft und der Politik ist wichtig, auch wenn nach wie vor der Eindruck besteht, dass nicht zwingend in allen Punkten ein gemeinsames Ziel von Landwirtschaft und Politik angesteuert wird. Wichtiger ist und bleibt weiterhin der Austausch mit den Berufskollegen und der kam in Münster auf keinen Fall zu kurz.
Ein Thema, welches intensiv diskutiert wurde, war das Projekt Zukunftsbauer. Die Landwirtschaft soll die Zukunft bauen. Vonseiten der Politik und der Bevölkerung wird ein Umdenken der Landwirtschaft gefordert, am besten schon gestern. Aber sind wir nicht oft schon dabei, für unsere Zukunft in unserem Handeln und Tun neue Strategien zu entwickeln?
Das geforderte Umdenken machen wir Bäuerinnen und Bauern oft tagtäglich, ob nun bewusst oder unbewusst. Dazu gehören neue Strategien in der Pflanzen- und Tierproduktion, dem Wein- und Obstbau oder allgemein komplett neue Ideen und Wege, unsere Landwirtschaft zu betreiben. Viele dieser Entwicklungen, die beispielsweise massiv Emissionen einsparen, kommen in der breiten Öffentlichkeit noch nicht an oder werden politisch nicht ausreichend berücksichtigt. Die Vermarktung unserer Leistungen müssen wir noch ausbauen.
Innovation wird uns seitens der Politik aber auch nicht leicht gemacht. Ausstehende oder fehlende politische Entscheidungen bremsen die Entwicklung. Teilweise sind politische Entscheidungen aus fachlicher Sicht schlicht nicht nachvollziehbar. Es wird einem nicht leicht gemacht, einen positiven Blick zu haben, die Zukunft „zu bauen“.
Trotzdem stellt Aufgeben keine Option dar! Auch ich komme an Punkte, wo mich das Empfinden plagt, ich grüble, wo die Reise in der Landwirtschaft hingeht. Und manchmal bringt das Grübeln über neue Informationen einen auf ganz neue Ideen. In meinem Fall die Produktion von Mikroalgen. Mancher mag es verrückt nennen, ich habe für unseren Betrieb eine große Chance gesehen, durch diesen neuen Weg die Zukunft der Landwirtschaft neu- und mitzubauen – ein Zukunftsbauer sein. Mikroalgen sind natürlich keine klassischen Feldfrüchte, denn schließlich ist ihr Hauptmedium das Wasser und es erinnert mehr an ein Aquarium. Aber auch die Mikroalgen wollen mit viel Leidenschaft und Liebe, so wie alle anderen Landkulturen auch, produziert werden. Das Potenzial von Mikroalgen-Produkten ist immens! Da kann es schon mal passieren, dass man Schuhe aus Mikrolagen trägt oder ein kühles Algen-Bier in der Hand hält. Die vielfältige Weiterverarbeitung war jedoch erst der zweite Gedanke.
Meine anfängliche Überlegung war, welche Möglichkeiten wir als Nahrungs- und Futtermittel haben. Hierfür bietet unter anderem die Chlorella vulgaris, welche wir anbauen, ein breites Spektrum. Wie bei den Mikroalgen wächst der Markt stetig. Reich an Proteinen, Aminosäuren, Vitamin B 12 ist die Chlorella vulgaris als Nahrungs- und Tierfutter beliebt und kann da sogar viele Feldfrüchte toppen. Das Wachstum ist im Vergleich zu einer Feldfrucht um ein Vielfaches höher, Erntedankfest darf alle 3 Tage gefeiert werden. Im getrockneten Zustand ist dann die Chlorella vulgaris sehr haltbar, ohne von ihrer positiven Zusammensetzungen Qualitätseinbußen hinnehmen zu müssen. Was die Alge dafür benötigt, sind Grundnährstoffe, UV-Licht, Wärme, Kohlenstoffdioxid und ab und zu etwas Dextrose. Ansonsten ist die Chlorella vulgaris anspruchslos. Ich freue mich täglich auf das leuchtende Grün der Mikroalge und das wunderbare Summen der Motoren in der Anlage.
Obwohl bekannt ist, dass die Mikroalgen vor vielen tausend Jahren für das Leben auf der Erde maßgeblich verantwortlich waren, gibt es nach wie vor reichlich Forschungsbedarf. Auch wir wollen weiter in die Tiefe der Möglichkeiten von Mikroalgen eintauchen und haben drei Forschungsprojekte vom BMEL und VDE/VDI genehmigt bekommen. Aktuell starten wir mit der Nutzung des „Algen-Abwassers“, welches bei der Ernte entsteht, zur Bewässerung von Weinstöcken. Wir erwarten positive Effekte in Bezug auf die Weinstock- und Blattgesundheit. Es bleibt auf jeden Fall nicht nur abzuwarten, sondern es bleibt spannend und Ideen habe ich in diesem Bezug noch jede Menge.
In unterschiedlichen Ansätzen entwickeln wir Landwirtinnen und Landwirte auf unseren Betrieben Konzepte für die Zukunft. Wir müssen unsere Innovationen nach außen tragen! Seit dem Mittelalter gilt der Spruch „Klappern gehört zum Handwerk.“ Und wenn man merkt, wie positiv eine kleine oder große Innovation von den Mitmenschen wahrgenommen wird, schöpft man auch frischen Mut für die Dinge, die in der Zukunft liegen.
Ihre Katrin Beberhold
Vizepräsidentin Bauernverband Sachsen-Anhalt
Blick ins Heft