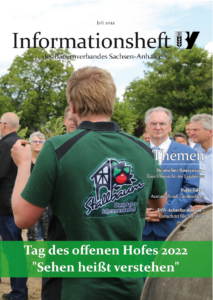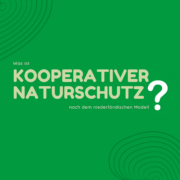Was die Aussetzung der erweiterten Stilllegung 2023 für Sachsen-Anhalt bedeutet
4 Prozent – um diese Zahl haben die Agrarminister der Länder, das Bundeslandwirtschaftsministerium (BMEL) von Cem Özdemir und unsere Landwirte in den vergangenen Monaten diskutiert.
Ursprünglich war vonseiten der EU vorgesehen, dass Landwirte ab 2023 von ihrer Ackerfläche 4 Prozent stilllegen müssen, um für die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) förderberechtigt zu bleiben. Solche stillgelegten Flächen dürfen durch den Landwirt nicht für den Anbau von Weizen, Raps oder anderen Kulturen genutzt werden. Die EU-Kommission hatte vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine beschlossen, dass die Mitgliedsstaaten diese Vorgabe ein Jahr lang aussetzen können. Dagegen hatte sich Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir lange verwehrt. Bereits seit März wurde die Aussetzung neuer Stilllegungen gefordert, von Landwirten und vielen Länder-Agrarminister wie Sachsen-Anhalts Minister Sven Schulze.
Anfang August hat das BMEL bekannt gegeben, dass es einen Vorschlag an die Länder gebe, der eine Aussetzung der erweiterten Flächenstilllegung enthält. Auf den vorgesehenen Flächen soll weiterhin ein landwirtschaftlicher Anbau möglich sein. Dabei sind Flächen, die in den Jahren 2021 und 2022 bereits freiwillig stillgelegt wurden, davon ausgeschlossen. Durch diese Entscheidung werden die bereits etablierten Stilllegungen nicht weniger. Wissenschaftlichen Berechnungen zufolge können durch diese Maßnahme 100.000 bis 180.000 Hektar weiter für den Anbau von Lebensmitteln genutzt werden, so die Erläuterung des BMEL.
In Sachsen-Anhalt sind bereits jetzt 2,3 Prozent der Ackerflächen stillgelegt, das entspricht 22.280 Hektar. Mit der Vorgabe von 4 Prozent Stilllegung wäre diese Zahl auf knapp 39.000 Hektar gestiegen. Weil diese Vorgabe ein Jahr ausgesetzt wird, bleiben rund 16.720 Hektar weiter in der Bewirtschaftung. Auf dieser Fläche dürfen die Landwirte 2023 u.a. Weizen, Roggen, Erbsen und Sonnenblumen anbauen.
Wenn im kommenden Jahr auf der Hälfte dieser 16.720 Hektar Weizen angebaut wird, kann das bei Anbaubedingungen wie in diesem Jahr zu 50.000 Tonnen Weizen führen. Bei guten Bedingungen, also wenig Hitze und mehr Regen, ist auch deutlich mehr möglich. Und das gilt allein für Sachsen-Anhalt. Damit kann unsere Landwirtschaft einen wichtigen Beitrag zur Ernährungssicherheit leisten.
Für die landwirtschaftlichen Praktiker ist jetzt zum einen wichtig, dass die Ankündigung des Bundeslandwirtschaftsministers schnell rechtlich festgeschrieben wird. Zum anderen darf die Bundespolitik für die einjährige Aussetzung nicht andere, bestehende Vorgaben an die Landwirte zusätzlich erhöhen.
Stilllegungen haben das „Ziel des Erhalts und der Steigerung der Biodiversitätsleistungen“, so die Begründung des BMEL. Dies sehen viele Landwirte kritisch und würden lieber kooperativ Maßnahmen umsetzen. Statt Flächen stillzulegen und zu hoffen, dass diese der Biodiversität nützen, können Landwirte auch aktiv Maßnahmen umsetzen. Dadurch könnten Tier- oder Pflanzenarten gezielt unterstütz werden. Projekte dazu gibt es bereits, in Sachsen-Anhalt betreut durch die Stiftung Kulturlandschaft Sachsen-Anhalt.